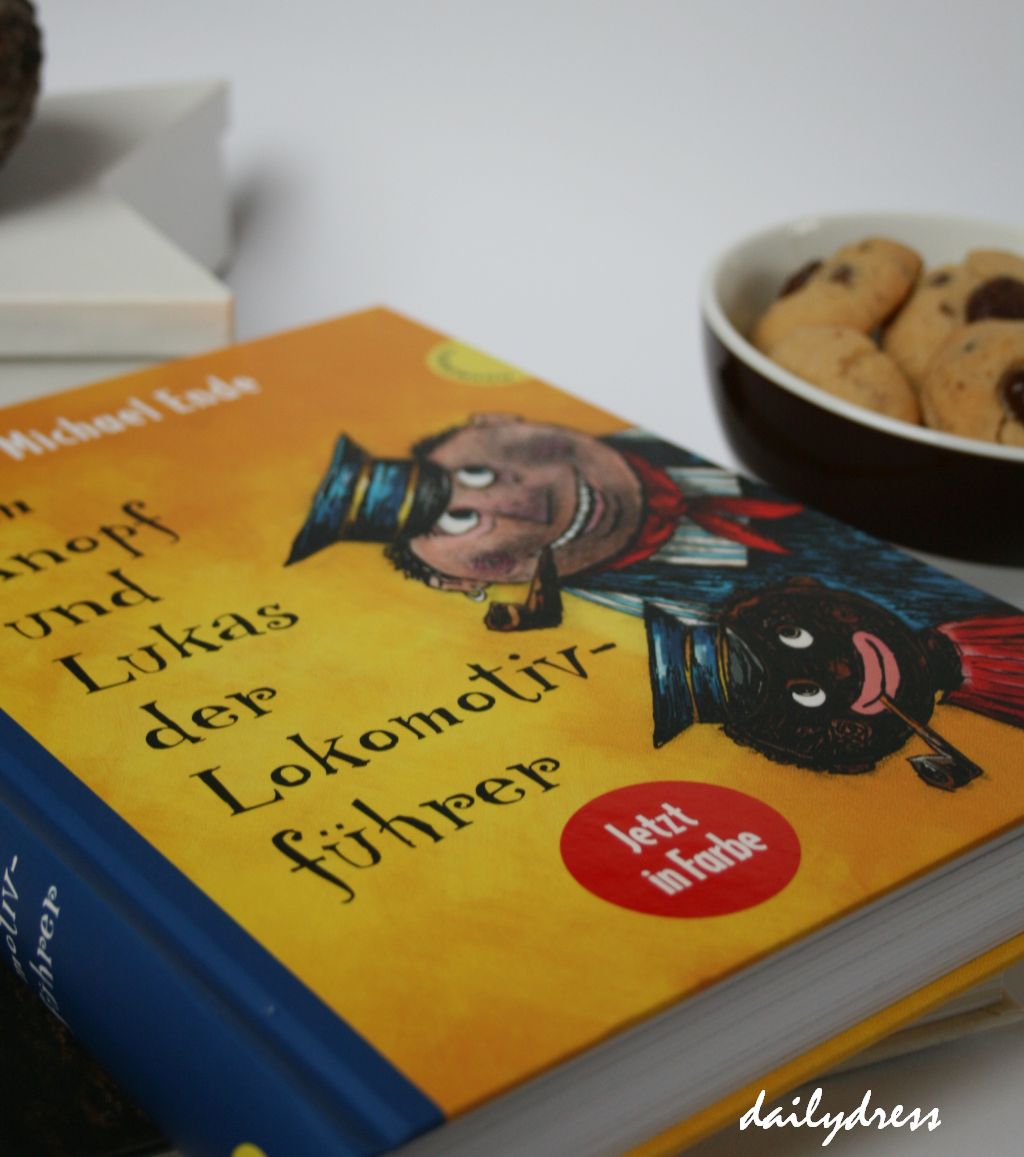“Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages” – kennt ihr den Spruch? Ich habe die Stimme meines Papas noch im Ohr. Und weil ich eine folgsame Tochter war, löffelte ich Jahr für Jahr jeden Morgen ein bisschen (sorry Papa) Gruselmüsli. Es gab geschroteten Weizen, der über Nacht in Wasser eingeweicht wurde. Morgens kam er in kühlschrankkaltes, weißes Joghurt. Dazu wurde Obst geschnibbelt wie Mandarine oder Kiwi.


Ich erinnere mich also noch mit leichtem Schaudern an kaltes, säuerliches Joghurt mit saurem Obst. (Sicher gab es auch schmackhaftere Varianten, aber die sind mir vermutlich nicht so ausgeprägt in Erinnerung geblieben).
Als ich dann die elterliche Behütung verließ, wurde das morgendliche Mahl ersatzlos gestrichen. Kaffee und gut. Und dann geschah es, dass ich Mama wurde. Und das Kind irgendwann so groß, dass ein morgendliches Frühstück anstand. Und ich hörte, wie ich sagte: “Du kannst nicht gar nichts essen, denn das Frühstück ist die wichtigste Mah…” History repeating. Irgendwie.
Das mit dem Weizenschrot war definitiv keine Option. Und so suchten wir Alternativen, die wir beide zum Frühstück gut finden. Es gibt immer noch Tage, an denen das Fräulein partout nichts essen will und da sie im Kindergarten gemeinsam Pause machen und dort Äpfelchen knabbern, ist mir das dann auch nicht gar so wichtig. Verhungern wird das Kind nicht.

Und trotzdem habe ich rausgefunden, womit ich sie fast immer an den Tisch gelockt kriege. So besteht unser Frühstück aus folgenden drei Komponenten:
Joghurt
Wir essen grundsätzlich nur weißes Joghurt, weil in den allermeisten Fruchtjoghurts alles drin ist, außer Frucht. Oder höchstens in homöopathischer Dosierung. Der Rest ist Zucker und Gedöns, was wirklich keiner braucht. Schon gar nicht bei der wichtigsten Mahlzeit des Tages! (jaja, ich hör schon auf).
Erkenntnis eins: Magerjoghurt geht gar nicht. Mögen wir einfach nicht.
Erkenntnis zwei: Normaler weißer Joghurt ist ok, aber der absolute Favorit ist griechischer Joghurt. Der hat zwar mehr Fett und Eiweiß als anderer, dafür ist er unwiderstehlich mild und cremig. Für uns die perfekte Grundlage fürs Müsli.

Obst
Hier kann man sich einmal queer durch den Obstgarten futtern. Wobei wir auch da unsere Lieblinge haben. Saures Obst wie Kiwi, Mandarinen, Zitrusfrüchte allgemein kommen weder bei mir noch bei der kleinen Miss gut an. Also essen wir Äpfel, Birnen, Bananen, manchmal ein paar Weintrauben, Blaubeeren, im Sommer Beeren aus dem Garten. Grundsätzlich gilt in meiner Küche der Grundsatz regional vor bio. Wenn beides geht, ist das natürlich super (aber find mal regionale Bananen!).
Müsli
Mittlerweile ist unser Vorratsregal eine kleine Kornkammer. Denn nicht jeden Morgen mag das Fräulein Haferflocken. Manchmal behauptet sie sogar vehement, noch NIE Haferflocken gemocht zu haben. Auch wenn sie am Vortag noch Nachschlag verlangt hatte. Also gibt es bei uns Cornlakes ohne Zucker, Amaranth-Pops, Dinkelcrunchys (die von Alnatura sind mein Favorit) und natürlich auch fertige Mischungen von MyMüsli zum Beispiel (das Fräulein steht aufs Prinzessinnenmüsli, ich vermute, die Verpackung war ausschlaggebend, ich eher aufs Schokomüsli. Wegen der Schokolade. Is klar.)
Wenn ich ganz viel Lust habe, mache ich mein Müsli auch mal selbst, ich habe ein Rezept von Joanna von Liebesbotschaft abgespeichert, das mache ich immer mal wieder und es ist wirklich lecker. Auch wegen der Schokolade.


Ich habe zwei Lieblingskombis für Euch aufgeschrieben und in Szene gesetzt, weil Bilder der bessere Erklärbär sind: Eine Variante besteht aus Apfel- und Birnenspalten, Dinkelcrunchies und Joghurt, die andere aus Blaubeeren, zarten Schmelzflocken (weil das Kind Tage hat, an denen es nichts hartes knuspern will, Frühstücksstatus: es ist kompliziert) und einer Quarkcreme.
Und wenn das alles nichts hilft und das Kind permanent jegliche morgendliche Nahrungsaufnahme verweigert, ziehe ich den Joker, den der Papa ins Haus geschleppt hat: Rainbow-Unicorn-Froot-Loops von Kellogs. Aber diesen Satz habe ich nie geschrieben und ihr habt ihn nie gelesen, verstanden?



Guten Appetit wünsch ich Euch.